Aktuell | 16. April 2025
Start-up-Gründung: Simon Riedener über die Hürden und seine Learnings
Gründen während des Studiums – ein Wagnis oder eine Chance? Simon Riedener, HWZ-Absolvent und CEO des Start-ups QuantalQ, teilt im Interview, wie er aus einer Idee ein skalierbares Produkt entwickelt hat. Er erzählt, was es bedeutet, Investor:innen zu überzeugen, welche Hürden und Herausforderungen auf dem Weg liegen und was er angehenden Gründer:innen rät.
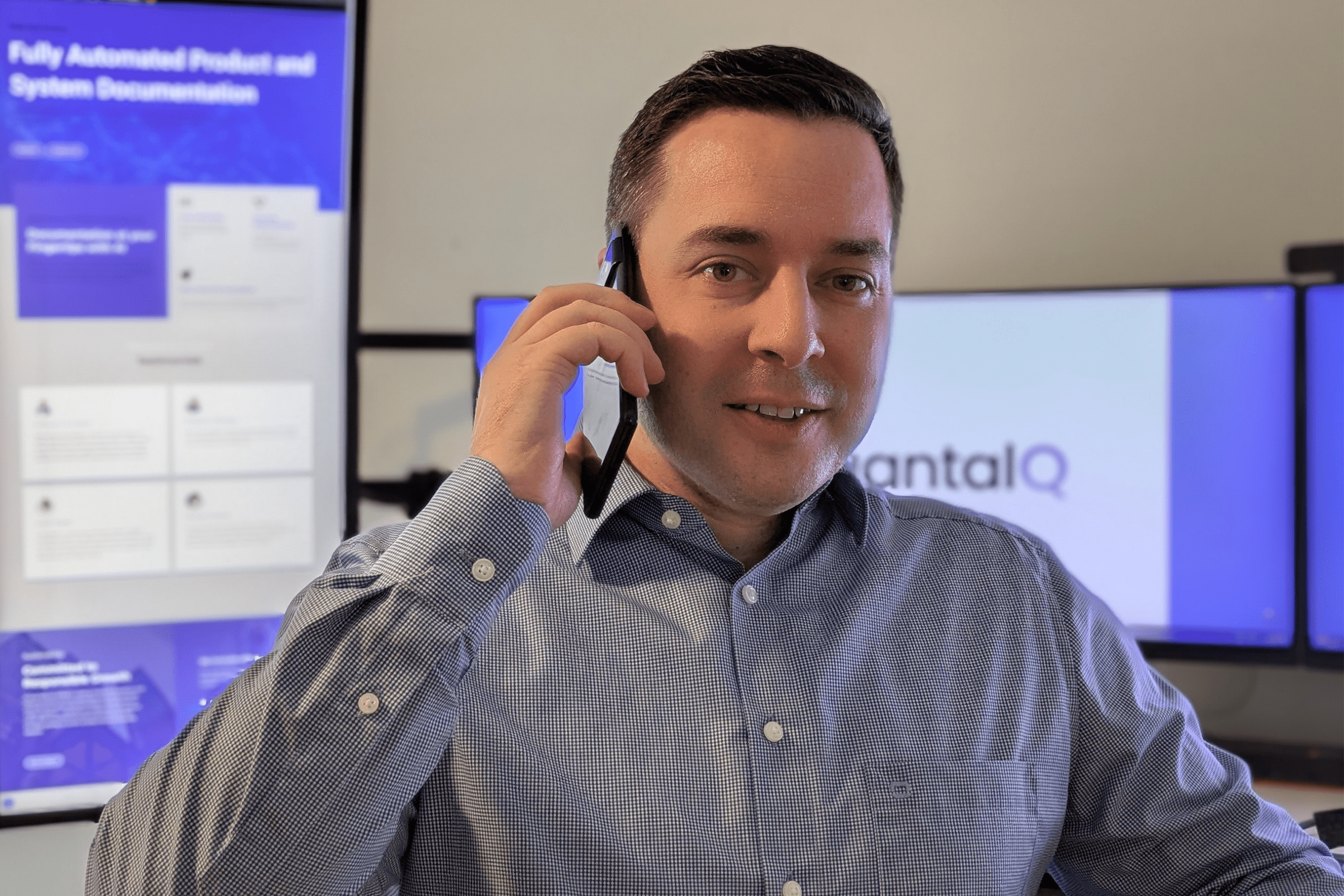
Wie wird aus einer Idee ein erfolgreiches Unternehmen, das echten Mehrwert bietet? Simon Riedener, Absolvent der HWZ und CEO von QuantalQ, gibt im Interview Einblicke in die Entstehung seines Start-ups. Wir haben ihn nach seinen Höhen und Tiefen der Gründungsphase gefragt, nach Themen wie Investorengespräche und Eigenverantwortung – und darüber, wie die HWZ ihm geholfen hat, Theorie und Praxis zu verbinden.
Simon, du bist seit September 2024 CEO des Start-ups QuantalQ. Was steckt genau hinter eurem Unternehmen, und worauf fokussiert ihr euch?
Unsere Mission bei QuantalQ ist es, die Effizienz und Qualität in Unternehmen nachhaltig zu steigern. Ein erstes konkretes Produkt daraus ist QuantalQ Doc – eine KI-basierte Softwarelösung, die automatisch Software- und Systemdokumentationen erstellt, aktualisiert und zugänglich macht. Jede:r, der schon einmal an Softwareprojekten gearbeitet hat, weiss: Dokumentation ist wichtig, aber oft veraltet, unvollständig oder sogar fehlerhaft. Zudem ist das Schreiben von Dokumentationen zeit- und kostenintensiv. Genau da setzen wir an: QuantalQ Doc analysiert automatisiert den Code, erkennt Zusammenhänge, versteht Prozesse und generiert daraus verständliche Beschreibungen des aktuellen Produktstatus. Das spart nicht nur wertvolle Entwicklerzeit, sondern stellt auch sicher, dass Wissen im Unternehmen erhalten bleibt – und dass alle Beteiligten, von Entwickler:in bis zu Produktmanager:in, das gleiche Verständnis vom Produkt haben. Gerade in dynamischen Projekten sorgt das für mehr Effizienz, bessere Zusammenarbeit und fördert echte Innovation – weil sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren können.
Der Markt für KI-gestützte Softwarelösungen stelle ich mir in der aktuellen KI-Welt hart umkämpft vor. Wie schafft man es, sich in einem solch wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten?
Es stimmt, dass viele Start-ups, aber auch etablierte Unternehmen, derzeit auf den KI-Zug aufspringen.
Doch nur weil ‹KI› draufsteht, bedeutet das noch lange nicht, dass ein Produkt vom Markt auch angenommen wird. Entscheidend ist, ob man echten Mehrwert schafft, durch Lösungen, die konkrete Probleme adressieren und einen messbaren Nutzen bieten.
Unser Fokus liegt deshalb stark auf Customer Validation – also darauf, unsere Annahmen frühzeitig mit realen Marktbedürfnissen abzugleichen. Wir suchen den engen Austausch mit potenziellen Kund:innen, testen unsere Entwicklungsschritte im realen Umfeld und schärfen dadurch unsere Value-Proposition kontinuierlich nach. Gerade im B2B-Bereich bekommen wir dabei sehr konstruktives Feedback – nicht selten entstehen daraus sogar Ideen für neue Funktionen oder völlig neue Produkte für unsere Produktpipeline. Langfristig ist es in einem so dynamischen Umfeld entscheidend, offen für die nächsten technologischen Entwicklungsschritte zu bleiben und gezielt das zu nutzen, was das Produkt voranbringt.
Welche Hürden oder Herausforderungen hast du in der bisherigen Start-up-Phase erlebt?
Herausforderungen sind mir aus meiner Erfahrung aus dem Engineering- und Softwareumfeld nicht fremd. Was im Start-up aber anders ist: Als Gründerteam trägt man plötzlich die Verantwortung für alles, was in einer Firma so anfällt. Man denkt zwar, dass man in einem Unternehmen versteht, was die anderen Divisionen tun – doch erst als Gründer sieht man wirklich tiefer, was noch alles dahintersteckt – wenn man es selbst machen muss.
Eine Herausforderung war sicherlich der Aufbau des Start-ups parallel zum Hauptjob. Man sieht zwar Fortschritte, doch hat man dennoch das Gefühl nicht vom Fleck zu kommen. Schliesslich möchte man dem Arbeitgebenden gegenüber die gewohnte Leistung bringen. Wenn man aber an die eigene Idee glaubt, ist es nur logisch, sich mit der Zeit stärker darauf zu fokussieren und muss es irgendwann wagen, den Schritt ins volle Unternehmertum zu tun.
Parallel dazu fallen viele Aufgaben an, die mit dem Produkt nur am Rande zu tun haben, aber trotzdem unerlässlich sind: rechtliche Abklärungen, administrative Abläufe, passende Tools, Buchhaltung. All das kostet Zeit und Energie, ohne dass man unmittelbar mit dem Produkt vorankommt.
Auch die Finanzierung ist ein ständiges Thema. Zwar konnten wir mit Eigenmitteln starten, was uns gewisse Freiheiten verschafft hat. Aber früher oder später stellt sich die Frage trotzdem: Wie effizient kann man mit eigenen Mitteln wachsen, und wann ist der richtige Zeitpunkt, um externe Investoren ins Boot zu holen? Und vor allem: Welche Investoren passen wirklich zum Unternehmen und zur Produktvision – und können einen bei den nächsten Entwicklungsschritten unterstützen?
Gleichzeitig sehen wir, dass es nicht ausreicht, ein funktional starkes Produkt zu entwickeln – es muss auch sichtbar gemacht werden. Aufmerksamkeit entsteht nicht automatisch. Marketing, Kommunikation und Networking sehe ich ebenso als erfolgsentscheidend wie das Produkt selbst. Diese Aufgaben erfordern substanzielle Ressourcen, was gerade in der frühen Phase herausfordernd ist – vor allem, wenn die Teamkapazitäten noch verhältnismässig klein sind.
Wie überzeugt man als junges Unternehmen Investor:innen von seiner Vision?
Ich denke, es gibt nicht DEN Investor – jede:r hat unterschiedliche Interessen, Werte und Schwerpunkte. Deshalb finde ich es wichtig, mich gut zu informieren, um zu verstehen, was einem potenziellen Investor wichtig ist: In welcher Branche investiert er oder sie typischerweise? Gibt es einen Fokus auf Impact, Nachhaltigkeit oder Technologie? Eigentlich ist das selbstverständlich, denn es geht um eine potenzielle Partnerschaft – und da möchte auch ich wissen, mit wem ich es zu tun habe.
Aus den bisherigen Gesprächen mit Investoren nehme ich vor allem mit, dass es nicht die eine perfekte Antwort oder den einen Pitch gibt. Vielmehr ist es ein Lernprozess, bei dem man mit jeder Unterhaltung neue Perspektiven und Fragen mitnimmt – und sich selbst und das eigene Geschäftsmodell weiter schärft.
Wiederkehrende Themen sind unter anderem: der konkrete Kundennutzen, das Marktpotenzial, die Differenzierung gegenüber der Konkurrenz, die Skalierbarkeit des Modells sowie die Zusammensetzung und Motivation des Teams. Auch Finanzierungsstrategie und langfristige Vision spielen eine zentrale Rolle.
Was ebenfalls hilfreich ist: Das Start-up und das Produkt auch ohne Pitch Deck in wenigen Sätzen erklären zu können – denn man hat nicht immer gleich alle Unterlagen zur Hand.
Wie hat dein Studium an der HWZ dazu beigetragen, dass du dein eigenes Unternehmen gründen konntest?
Vor allem das CAS General Management, aber auch das CAS Agile Business Analysis, haben mir nochmals einen wertvollen Überblick über die zentralen Kernbereiche eines Unternehmens gegeben. Mit vielen dieser Themen war ich in meiner bisherigen Laufbahn bereits in Berührung gekommen oder waren wichtiger Bestandteil meines Fachbereichs. Trotzdem war es sehr hilfreich, die Inhalte nochmals strukturiert aufzufrischen, in Zusammenhang zu bringen und neue Perspektiven zu gewinnen.
Besonders profitiert habe ich vom Austausch – sowohl mit den Dozierenden, die ihre Praxiserfahrung offen geteilt haben, als auch mit den Mitstudierenden, die ganz unterschiedliche Hintergründe mitgebracht haben. Diese Kombination aus Theorie, Anwendung und Erfahrungen waren für mich eine ideale Vorbereitung, um den Schritt ins Start-up zu wagen.
Welche Erkenntnisse aus dem CAS General Management und CAS Agile Business Analysis wendest du heute konkret bei QuantalQ an?
Es sind unzählige kleine Erkenntnisse, die ich aus den beiden CAS mitgenommen habe und die im Alltag immer wieder an passender Stelle „aufpoppen“. Drei Beispiele sind mir besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben und begleiten mich regelmässig im Alltag:
Auf Basis der gelernten Methoden konnte ich unsere Finanzplanung Schritt für Schritt aufbauen und kann daraus Szenarien ableiten. Ich bin überzeugt, dass ich durch das entsprechende Modul an der HWZ viel Zeit eingespart habe – im Vergleich dazu, wenn ich von Grund auf hätte starten müssen.
Besonders nützlich waren für mich die einfachen, aber klaren Ansätze zur Strategieentwicklung. Sie helfen uns dabei, unsere Strategie auf Basis von verschiedenen Umweltfaktoren zu erstellen und danach zu handeln.
Das Modul Marketing hat mir aufgezeigt, wie eng Marketing und Kommunikation miteinander verknüpft sind – und dass Kommunikation immer eine bestimmte Wirkung erzeugt. Diese Wirkung kann positiv sein, aber auch ernsthafte negative Folgen haben, wenn man sich zu wenig Gedanken über Zielgruppe, Botschaft und Timing macht.
Was würdest du anderen Studierenden raten, die mit dem Gedanken spielen, sich während des Studiums selbstständig zu machen?
Sich selbstständig zu machen, nur um selbstständig zu sein, wäre wohl nicht sinnvoll. Aber wenn du eine Idee hast, von der du überzeugt bist, oder noch besser – von der auch andere überzeugt sind (nicht nur deine engsten Freunde oder die Familie) – hast du eine gute Ausgangslage. Das Studium kann dafür der ideale Rahmen sein:
Du kannst das Gelernte laufend auf dein Vorhaben anwenden und hast direkten Zugang zum Expertenwissen der Dozierenden. Wenn du es nicht eilig hast, kannst du die Zeit im Studium nutzen, um deinen Business Case zu verifizieren und Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und anschliessend das Unternehmen zu gründen.
Weiteres Bildungsangebot
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich Lagerstrasse 5, Postfach, 8021 Zürich +41 43 322 26 00
ImpressumDatenschutzRechtliches

